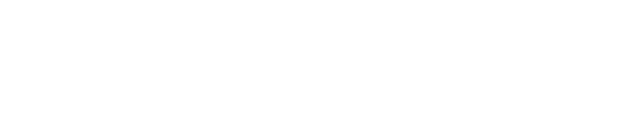16/25
Nürnberger Nachfolgeprozesse – Neuer Podcast der BAdW online
Nach dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess wurden ab 1946 in zwölf weiteren Verfahren zentrale Funktionseliten des NS-Regimes vor Gericht gestellt. Ein Projekt der BAdW digitalisiert nun erstmals das Archivmaterial dieser Prozesse und wird damit die Quellen weltweit zugänglich machen. Warum die digitale Aufarbeitung der Nürnberger Nachfolgeprozesse nicht nur ein Gewinn für die Forschung, sondern ein Schlüssel für unser rechtsstaatliches Verständnis ist, erklären Historikerin Simone Derix, KI-Experte Björn Eskofier und Jurist Christoph Safferling im neuen Podcast „Angeklagte in der zweiten Reihe“ – jetzt in der BAdW-Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt.
Unmittelbar nach den Nürnberger Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs starteten vor amerikanischen Militärgerichten die sogenannten Nürnberger Nachfolgeprozesse. 185 hochrangige Juristen, Mediziner, Industrielle, SS- und Polizeiführer, Militärs, Beamte und Diplomaten wurden in insgesamt 12 Prozessen angeklagt. Von den 185 Angeklagten erhielten 24 die Todesstrafe, 20 wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, 98 erhielten teils langjährige Freiheitsstrafen. 35 der Beschuldigten wurden freigesprochen. „Diese zwölf großen Prozesse vertraten eine spezifische Anklagestrategie“, erklärt der Jurist Christoph Safferling. „Man wollte die Funktionseliten Deutschlands repräsentieren, stellvertretend für die gesamte Gesellschaft, und deren Involviertheit in den Nationalsozialismus verdeutlichen. Sie waren quasi das Vorbild und schufen auch den rechtlichen Rahmen für die deutschen Prozesse gegen NS-Verbrecher, die ab Ende der 1950er Jahren folgten, etwa beim Ulmer Einsatzgruppen-Prozess im Jahr 1958 oder den Frankfurter Auschwitz-Prozessen der frühen 1960er Jahre.“ Historikerin Simone Derix erklärt, dass das Ziel der Prozesse über die juristische Aufarbeitung hinausging: „Die Idee war, dass das Völkerrecht in der Lage ist, solche Menschheitsverbrechen zu ahnden. Und gleichzeitig zielten die Prozesse auch auf eine Aufklärung der deutschen Bevölkerung. Das war ein Teil des Reeducation-Gedankens: Wir zeigen euch in einem juristischen Verfahren, was passiert ist. Daher wurde dort auch die deutsche Geschichte verhandelt.“
Nürnberg als Präzedenzfall des Völkerstrafrechtes
Die Bedeutung der Nürnberger Nachfolgeprozesse erschöpft sich jedoch nicht in der Ahndung nie dagewesener Menschheitsverbrechen und der Reeducation der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Bis heute prägen sie das internationale Völkerrecht, wie Christoph Safferling weiß: „Da die Nürnberger Nachfolgeprozesse im Grunde der erste Anwendungsfall für das Völkerstrafrecht waren, sind sie als Präzedenzien unglaublich wertvoll. Das sieht man etwa am Beispiel des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien oder des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Dessen Chefankläger hat neulich bei einem Besuch in Nürnberg öffentlich erklärt, der Internationale Strafgerichtshof sei ein Kind Nürnbergs. Fragen, die sich damals stellten, stellen sich heute in Den Haag am laufenden Band.“
Chancen der Digitalisierung und Unterstützung durch KI
Im Laufe der Prozesse entstanden etwa 2,5 Millionen Blatt an Prozessakten, die im Original im Staatsarchiv Nürnberg verwahrt werden: Aussagen von Zeugen, Anklageschriften, Stenografische Protokolle, Verteidigungsdokumente, Vernehmungsprotokolle und weitere amtliche und private Dokumente. Mit dem Projekt „Digital Nuremberg Military Tribunals“ (DigiNMT) ermöglichen die BAdW, die FAU Erlangen-Nürnberg und die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns die wissenschaftliche Aufarbeitung der Nürnberger Nachfolgeprozesse zu intensivieren. Im Zentrum des Projekts steht die digitale Präsentation der historischen Akten, die in drei Erschließungsstufen aufbereitet werden: Von der Digitalisierung über die Verschlagwortung bis hin zur zweisprachigen Kommentierung. Ziel ist es, die Prozessakten vollständig zu digitalisieren, strukturiert zu erschließen und auf einer interaktiven Plattform weltweit zugänglich zu machen. Die Dokumente sind trotz der schlechten Papierqualität der unmittelbaren Nachkriegszeit recht gut erhalten, berichtet Hubert Seliger von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, denn „[...] da viele Unterlagen auf amerikanischem Papier gedruckt wurden, ist der Zustand relativ gut.“ Was passiert, wenn Stellen doch nicht mehr lesbar sind und wie KI helfen kann, erklärt Björn Eskofier im Podcast: „Ein weiteres Einsatzgebiet sind schwer lesbare Stellen, etwa wenn der Text verblichen ist. Hier kann KI Vorschläge für unleserliche Wörter machen.“ Zusätzlich wird das Projekt Tools entwickeln, die Historikerinnen und Rechtswissenschaftler dabei unterstützen werden, mit der großen Datenmenge zu forschen.
Projekt „Digital Nuremberg Military Tribunals“ (DigiNMT)
Laufzeit: 2024 bis 2026
Finanzierung: Bayerische Akademie der Wissenschaften
Projektpartner: Bayerische Akademie der Wissenschaften, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien, Staatsarchiv Nürnberg
Kontakt: Prof. Dr. Christoph Safferling
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Fachbereich Rechtswissenschaft |E-Mail: Str1@fau.de